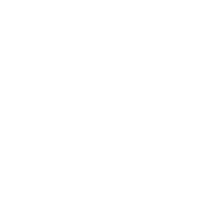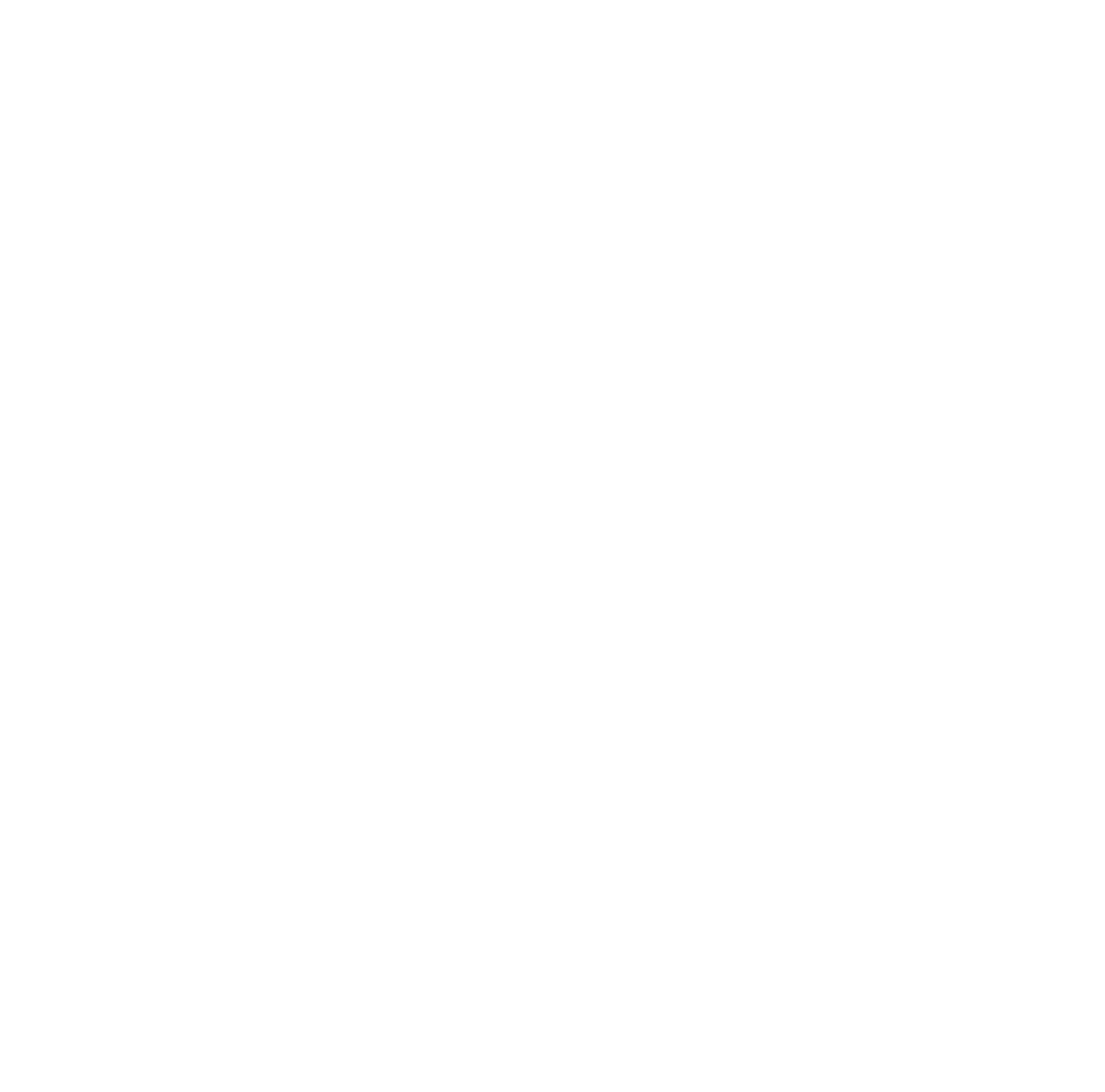„Wir haben den ganzen Weg laut gebetet“, sagt Diakon Mykola Serdjuk, als er beschreibt wie seine Familie das besetzte Dorf verließ
Interview vom 13.01.2023
Andrij Didenko
Zu Beginn des Krieges lebte Mykola Serdjuk mit seiner Familie im besetzten Dorf Hawryliwka bei Hostomel (Region Kyjiw). Um das Dorf zu verlassen, mussten sie unter Lebensgefahr russische Kontrollpunkte passieren. Sie sahen russische Panzerkolonnen, zertrümmerte Autos in Schützengräben, aber mit Gottes Hilfe und Gebet brachten sie sich in Sicherheit.

Mein Name ist Mykola Serdjuk. Ich bin Diakon in der Baptistenkirche in Kyjiw. Wir haben alle darauf gewartet, dass etwas passiert, weil so viel russisches Militärgerät an unsere Grenzen gekommen ist. Es war überall in den Medien. Wir Pastoren hatten vor dem Krieg ein Treffen. Uns wurde gesagt, was wir zu tun haben und wie wir uns im Krieg verhalten sollen. Niemand wusste, was während der Bombardierungen und Luftangriffe zu tun war.. Wir besprachen, wie reagiert werden könnte, wenn der Strom ausfiele usw.
Wir saßen in einer Sitzung und diskutierten, was im Falle eines Krieges zu tun sei, aber ich glaubte nicht, dass es wirklich zu einem Krieg kommen würde. Doch dann passierte es. Meine Tochter rief mich an und sagte, dass es in Charkiw brennt, und dann erfuhr ich, dass es auch in Wasilkiw brennt. Der Krieg, den wir fürchteten und den wir nicht wollten, hatte begonnen.
Es war dunkel und kalt. Ich ging zum Parkplatz, um mein Auto zu holen. Es war schwierig, die Stadt zu verlassen, weil alle Tankstellen voll waren. Wir fuhren aus Kyjiw heraus. Als wir losfuhren, sah ich viele Autos, die in die entgegengesetzte Richtung fuhren: Sie fuhren von Ljutezh (ein Dorf in der Region Kyjiw) nach Kyjiw. Ich dachte: „Wir verlassen also die Stadt, aber andere kommen in die Stadt? Warum ist das so?“ Anscheinend wussten die Leute, dass es in Kyjiw sicherer war. Weil Kyjiw besser geschützt war.
Meine Idee war einfach: Ich wollte meine Frau und unseren Enkel im Dorf lassen (ich dachte, das wäre sicherer) und dann nach Kyjiw zurückkehren. Aber als wir das Dorf erreichten, schrieb mir jemand im Viber-Chat, dass die Brücke in Hostomel bereits gesprengt worden sei. Ich sagte, wir sollten schnell packen, bevor sie die Brücke in Demidiw (ein Dorf in der Region Kyjiw) sprengen. Und sofort wurde mir mitgeteilt, dass auch die Brücke in Demidiw gesprengt worden war.
Um den 25. Februar (2022) fuhren die ersten russischen Militärfahrzeuge in die Region ein. Ich habe im Radio gehört, dass die russische Armee unsere Grenze überschritten hat. Sie fuhren durch Iwankiw (ein Dorf in der Region Kyjiw), beschlagnahmten das Kernkraftwerk Tschernobyl und fuhren in Richtung unseres Dorfes. Am Mittag des 25. Februar hörten wir ihre Ausrüstung.
Wir haben gehört, dass russische Fallschirmspringer auf dem Flughafen Hostomel waren. Sie haben den Flughafen eingenommen und es gab große Explosionen. Es war erschreckend. Es war ganz in der Nähe: 12-13 Kilometer von unserem Dorf. Sie (die russischen Truppen) drangen in das Nachbardorf Lubjanka ein und errichteten dort ihre Kontrollpunkte. Von dort aus begannen sie, Hostomel zu bombardieren. Dann wurde uns gesagt, dass Hostomel schon in Flammen stand. Alles brannte.
Am 25. (Februar) gab es im Dorf keinen Strom. Es gab noch Gas, aber es war kalt. Unsere Heizungen begannen abzukühlen und am 26. Februar gab es schwere Explosionen. Sie haben Butscha, Irpin und Hostomel bombardiert. Sie (die russischen Truppen) waren in der Nähe unseres Dorfes, und so wussten wir, dass unser Dorf besetzt war. Auf den Straßen war viel Militärgerät zu sehen, und wir wurden angewiesen, unsere Häuser nicht zu verlassen. Und wenn wir es taten, sollten wir weiße Armbinden tragen und anderen nicht sagen, wer Zivilist und wer Soldat war.
Die erste Bombe explodierte etwa 100 Meter von uns entfernt und ich sah viel Rauch. Ich hatte Angst. In den Häusern waren die Fenster zerborsten. Wir wussten, dass es gefährlich war. Es hätte schlimmer kommen können, wenigstens wurde keiner von uns verletzt.
Wir rannten schnell zurück in die Wohnung und eine Stunde später schlug eine zweite Bombe hinter dem Haus in der Nähe des Kindergartens ein. In einem Zimmer wurden unsere Fenster herausgesprengt, aber zum Glück war niemand im Zimmer. Aber jeden Moment konnte etwas in unsere Wohnung einschlagen. Wir packten zusammen, was wir konnten und verließen das Haus. Wir wussten, dass sich Menschen im Keller neben dem Kindergarten versteckten. Aber dort hatten sich so viele Menschen versammelt, dass kein Platz mehr war. Also sind wir in die Schule gegangen. Dort im Keller waren auch viele Leute. Da war auch kein Platz mehr. Aber es gab noch einen anderen Ort, wo wir uns verstecken konnten – ein Gemüselager. Die ersten zwei Nächte konnte ich nicht schlafen, ich war bis Mitternacht wach. Der Beschuss war so stark, dass es alle zwei bis drei Minuten Explosionen gab.
Bis 8. März hatten wir noch Gas. Ich bin am 8. März aufgewacht, habe meiner Frau und meiner Tochter zum Internationalen Frauentag gratuliert und bin dann in die Küche gegangen, um zu sehen, ob es Gas gibt. Es gab keines. Das war unsere letzte Hoffnung, etwas zu heizen, um uns zu wärmen. Und ich sah durchs Fenster, dass die Leute schon Brennholz trugen und Bretter zogen. Jemand versuchte schon, draußen ein Feuer zu machen. Uns wurde klar, dass wir das auch tun mussten, denn es war kalt. Die Explosionen waren so nah, dass die Fensterscheiben wackelten. Wir hatten Angst. Wir standen im Flur und warteten darauf, wo die Bombe einschlagen würde. Wir hörten, dass sie etwas weiter weg einschlug, also beruhigten wir uns. So war es jede Nacht.
Eines Tages standen wir in der Nähe der Schule, als russische Soldaten kamen und uns humanitäre Hilfe anboten. Ich ging hin, um zu hören, was sie anboten. Als ich näher kam, hörte ich ihre Sprache. Ich verstand, dass einer von ihnen Belarusse war. Denn mein Schwiegervater ist Belarusse und meine Frau ist Belarussin. Wir fuhren jedes Jahr nach Belarus und so erkannte ich immer ihren Akzent. Als eine Frau ihn fragte, wer er sei und woher er komme, sagte er nichts. Es gab auch Kadyrowzy (die inoffizielle Bezeichnung für die in der Republik Tschetschenien stationierten Einheiten der russischen Nationalgarde, des Innenministeriums und des Verteidigungsministeriums, deren Personal aus Tschetschenen rekrutiert wird), Russen und Belarussen.
Ich stand da, sah ihn (den belarussischen Mann) an und fragte: „Bitte sagen Sie mir, warum Sie hier sind? Was können Sie uns anbieten? Wir haben kein Gas, keinen Strom, keine Heizung, kein Essen. Ihr habt uns alles genommen und wollt uns etwas anbieten?“ Er antwortete sarkastisch: „Das waren nicht wir, das waren eure Ukrainer, die euch bombardiert haben“.
Ich sagte: „Die Bombardierung begann, als ihr kamt. Geht dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid. Sie – gehen nach Belarus, die Russen – geht nach Russland. Dann wird alles besser für uns, wir müssen von nichts befreiet werden“. Ich sah einen von ihnen hinter mir stehen, bewaffnet, mit einer Maske, nur seine Augen waren sichtbar. Er sah mich an, als hätte ich etwas Falsches gesagt. Wir hatten Angst vor dem, was sie in Butscha getan hatten, also winkte ich nur mit der Hand und sagte: „Nun, was gibt es mit Ihnen zu besprechen?“ Ich drehte mich um und ging.
Gegen Abend kam der Lärm von Maschinengewehrfeuer näher. Die Russen bewohnten Häuser im Wald und lebten sehr gut. Sie hatten Feuer und Essen. Man sagte uns, dass unsere Truppen vorrückten, dass sie begannen, die Russen zu vertreiben und dass sie (die russischen Truppen) durch den Wald flohen. Wir hörten diesen Nahkampf und sahen, wie sie (die russischen Truppen) aus dem Wald flohen. Sie versteckten sich zwischen den Häusern. Wir wussten, dass etwas passieren würde, und wenn wir das Dorf nicht verließen, würde es noch schlimmer werden.
Die Menschen gingen in einer Kolonne. Sie hatten ein weißes Tuch an einer Angel befestigt, um zu zeigen, dass sie evakuiert wurden. Die Kolonne ging in Richtung Demydiw. Ich sah, wie die Leute rannten und einige Autos wegfuhren. Auch wir begannen zu packen. Niemand verstand, was los war. Mein Schwiegervater sagte: „Wie kann ich in meinem Alter noch weggehen?“ Und ich sagte: „Pack deine Sachen, wir gehen nicht ohne dich!“ Wir bereiteten weiße Bänder vor, schnitten sie ab und befestigten sie am Auto, um zu zeigen, dass wir evakuiert wurden. Als wir aus dem Haus kamen, sagte ein Mann zu uns: „Kadyrowzy überprüfen die Leute an den Kontrollpunkten. Sie lassen euch nicht raus“. Das kam für mich unerwartet. Und ich dachte: „Gott, warum hast Du mir diesen Mann geschickt? Willst Du, dass ich hier bleibe? Ich übernehme die Verantwortung, meine Familie aus dem Dorf zu holen. Was ist, wenn ihnen, Gott bewahre, etwas zustößt? Ich werde meine Familie mitnehmen und wir werden durch diese Hölle gehen und ich weiß nicht, was passieren wird“.
Dann kamen andere Leute und erzählten andere Gerüchte. Sie sagten, dass im Nachbardorf Woronkiwka eine Familie das Dorf mit dem Auto verlassen wollte. Sie sahen ein gepanzertes Fahrzeug vor sich, und anscheinend geriet der Fahrer in Panik und fuhr vor ihnen weg, und sie (die russischen Truppen) schossen auf sie. Die ganze Familie wurde getötet.
Und dann hörte ich eine Stimme in meinem Kopf: „Geh!“ Ich begriff, dass Gott mit uns war. Er würde uns retten. Das war unser Schicksal. Wir stiegen alle ins Auto und beteten. Ich sagte zu meiner Familie: „Lasst uns gehen. Betet weiter“. So verließen wir das Dorf. Am ersten Kontrollpunkt standen ein gepanzertes Fahrzeug und vier Soldaten. Sie sahen uns an und wir fuhren weiter. Wir mussten durch das Dorf fahren, von dem aus sie auf Butscha geschossen haben. Wir wussten, dass es dort viel militärische Ausrüstung gab. Als wir uns dem Dorf näherten, sahen wir viele Panzer und andere militärische Ausrüstung. Wir passierten den zweiten Kontrollpunkt und auch hier kontrollierte das Militär unser Auto nicht, sondern schaute es sich nur an. Den dritten Kontrollpunkt passierten wir genauso. Wir beteten die ganze Zeit. Das Militär ließ uns durch, hielt uns aber an, als wir die Lubjanka verließen. Wir hoben die Hände und ich stieg aus. Ich fragte auf Russisch: „Lassen Sie uns durch?“ Sie schauten mich seltsam an. Ich sah einige Kadyrowzy auf dem Panzer sitzen. Einer von ihnen fragte mich mit russischem Akzent: „Habt ihr Zigaretten?“ Ich antwortete: „Wir sind religiös, wir rauchen nicht. Wir haben keine Zigaretten. Und wenn Sie uns durchlassen, werden wir beten, dass Gott Ihnen Weisheit gibt“.
Er sagte nichts, schaute nur auf das Auto und fragte, warum wir nicht genug weiße Bänder hätten. Ich sagte ihm, dass wir so viele wie möglich abgeschnitten und an die Autotür gehängt hatten. Er brachte zwei weiße Handtücher und half mir, sie an das Auto zu hängen, damit klar war, dass wir evakuiert wurden. Ich machte einen unglücklichen Witz und sagte, dass man uns so besser sehen würde und dass sie auf uns schießen könnten. Der Soldat antwortete mir: „Machen Sie sich keine Sorgen und fahren Sie vorsichtig. Wenn Sie unser Militärfahrzeug hinter oder vor sich sehen, halten Sie an und lassen Sie es passieren“.
Im Umkreis von 2-3 Kilometern zählten wir etwa 20 Panzer, die entlang des Feldes standen. Sie fuhren in Richtung Irpin und Hostomel. Einige Soldaten standen dort und rauchten, jemand saß auf den Panzern und alle Panzertürme waren in Richtung Kyjiw hochgezogen.
In der Nähe von Sdwyzhiwka (ein Dorf in der Region Kyjiw) sahen wir ein zerstörtes Auto auf der linken Seite des Straßengrabens. Es war ein weißer Renault Trafic. Und sein Fahrer lag tot daneben, mit Schnee bedeckt… Wir schauten nach rechts und sahen auch dort viele zerstörte Autos. Es war so furchteinflößend.
Auf der Fahrt haben wir laut geweint. Es ist schwer, sich an alles zu erinnern. Wir sahen ein Auto, das von einem Panzer überrollt wurde. Weiter hinten waren noch mehr zerstörte Autos. Ich konnte nur die Straße sehen, so verängstigt und konzentriert war ich. Andere Leute fuhren in ihren Autos weiter. Wir sahen sie auch, sie weinten und beteten. Wir erreichten Makariw (ein Dorf in der Region Kyjiw) und sahen unsere ukrainische Fahne. Das war eine große Freude! Als wir den Kontrollpunkt erreichten, wollte ich am liebsten aus dem Auto springen und unseren Soldaten dafür danken, dass sie da waren. Wir waren so froh, diesen Horror hinter uns zu lassen. Der Soldat fragte uns, wo wir herkommen. Wir antworteten: „Wir sind aus Hawryliwka“. Er antwortete: „Ach, dort ist es jetzt gefährlich“. Ich antwortete: „Ja, da haben Sie Recht“.
Wir hatten Glück, dass unser Dorf nicht schwer beschädigt wurde. Während der Fahrt habe ich das Lenkrad so fest umklammert, dass mir die Arme vor Anspannung weh taten. Erst als wir unseren ukrainischen Kontrollpunkt erreichten, beruhigten wir uns ein wenig. Wir waren der Hölle entkommen. Gott sei Dank!
Um 3 Uhr morgens waren wir in Jaworiw (einer Stadt in der Region Lwiw), wo ein Mann auf uns wartete. Er brachte uns zu einem Schutzraum in einer örtlichen Schule. Wir tranken heißen Tee und konnten uns ausruhen. Später fanden wir ein Haus, in dem wir bleiben konnten. Da nichts im Haus war suchten wir uns Feuerholz und entspannten uns ein bisschen. In der ersten Nach von Samstag auf Sonntag trafen plötzlich vier Raketen die Stadt. Ich wusste, dass eine Nowojaworiwsk Einheit in der Nähe war, die ein mögliches Ziel war. Wir hatten noch nie zuvor solche Explosionen gehört. Leute rannten aus ihren Häusern und beteten, Fenster sprangen aus der Fassung, alles bebte. Wir waren vor dem Krieg geflohen, doch der Krieg verfolgte uns.
Meine innere Einstellung zum Leben veränderte sich. Ich begann das Leben, die Menschen, meine Arbeit, meine Kollegen mehr denn je zu schätzen. Alles änderte sich. Meine Sicht auf die Welt hat sich komplett gewandelt.
Das Interview wurde von der Charkiwer Menschenrechtsgruppe vorbereitet und von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte übersetzt.