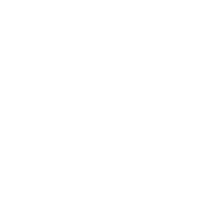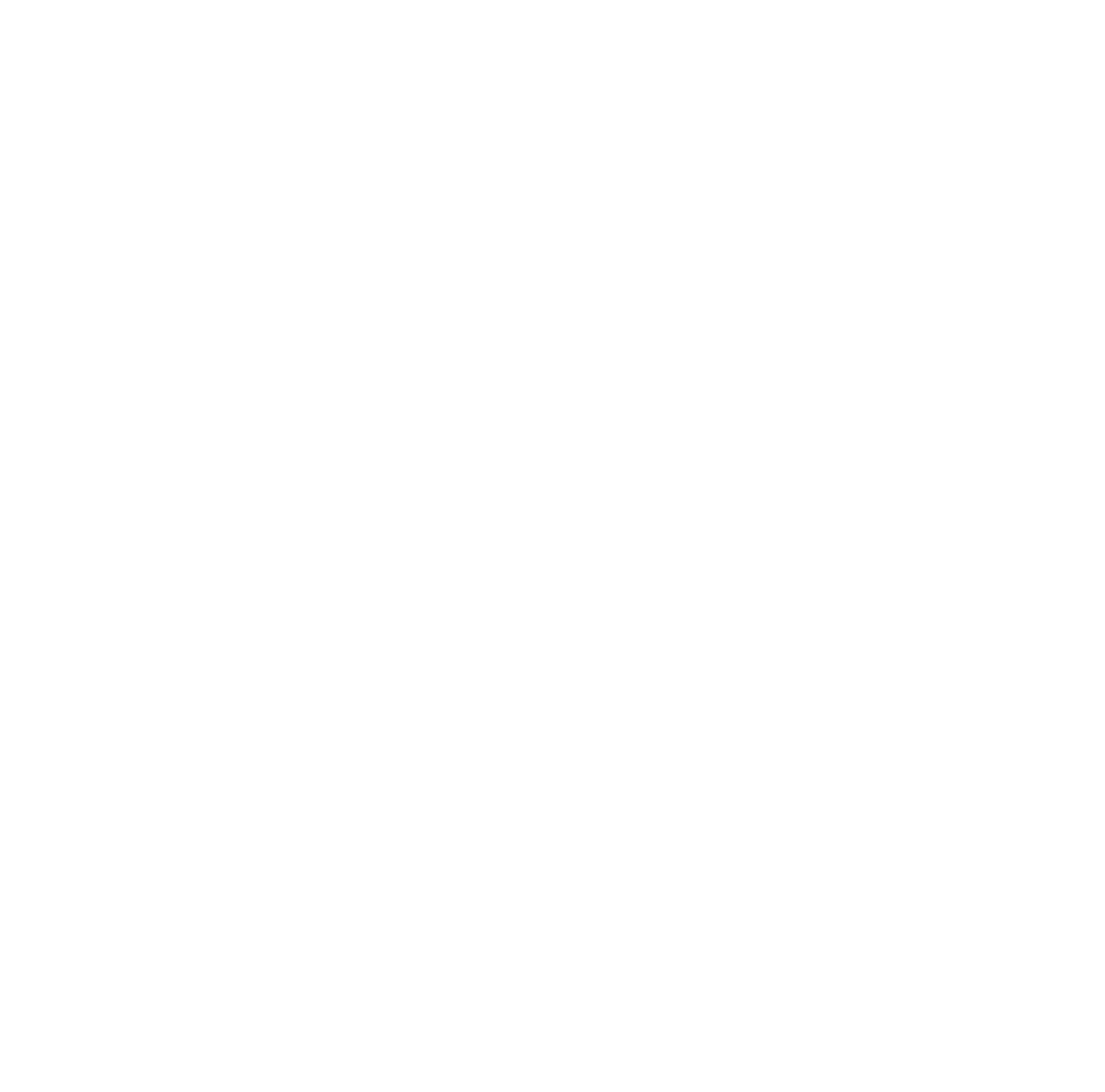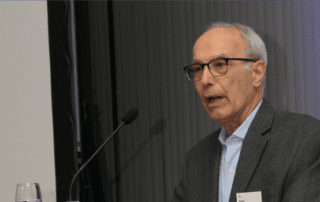Gabrielius Landsbergis

Der ehem. Außenminister Litauens, Gabrielius Landsbergis berichtet auf der 53. Jahrestagung der IGFM im März 2025 in Bonn über die Stärkung demokratischer Bewegungen und die Überwindung autoritärer Regime am Beispiel Litauens. Landsbergis warnt vor der Gefahr Russlands, „wenn wir jetzt schweigen, gibt es vielleicht morgen niemanden mehr, der für uns spricht“.
„Der Kampf für die Demokratie – wenn wir jetzt schweigen, gibt es vielleicht morgen niemanden mehr, der für uns spricht“
Bonn, der 29. März 2025
Liebe Freunde, Kollegen und Partner im Kampf für die Demokratie,
wir kommen zusammen, um zu besprechen, wie wir demokratische Bewegungen stärken und Autoritarismus überwinden können. Dies tun wir in einem kritischen Moment, nicht nur für die Ukraine, nicht nur für Osteuropa, sondern für die gesamte demokratische Welt.
Wir erleben eine wahre Zeitenwende, eine Zeitenwende, in der über die Zukunft der demokratischen Welt entschieden wird. Der globale Wettstreit zwischen offenen Gesellschaften und autoritären Regimen verschärft sich, und unsere Antwort, ob sie uns gefällt oder nicht, ist keine Option. Selbst wenn wir uns lieber abwenden würden, ist Neutralität kein Luxus, den sich die Demokratie leisten kann. Die Verteidigung der Freiheit ist unsere Pflicht und Verantwortung, ohne sie ist die Demokratie zum Scheitern verurteilt.
Litauen kennt diesen Kampf nur zu gut, nicht nur als ehemalige gefangene Nation des Sowjetimperiums, sondern auch als demokratischer Staat, der sich nach Jahrzehnten der Besatzung und Unterdrückung, neu aufbauen musste.
Unsere Geschichte ist nicht abstrakt. Sie ist aktuell. Sie ist lebendig.
Zur Aufzeichnung der Rede von Gabrielius Landsbergis:
In unserem kollektiven Gedächtnis sind die Deportationen, das Verstummen unserer Sprache und unseres Glaubens, die Jahre, in denen unsere Souveränität verweigert und unsere Zukunft von außen diktiert wurde. Aber in dieser Erinnerung ist auch noch etwas anderes: ein entschlossener, geeinter Widerstand, der die Idee der nationalen Freiheit und der demokratischen Regierungsführung nie aufgegeben hat.
Und heute wage ich zu sagen: Die 70 Prozent der Weltbevölkerung, die laut führenden Forschungsergebnissen heute unter autoritären Regimen leben, sei es in Belarus, in den besetzten Gebieten der Ukraine, in Moldawien, Georgien, Russland, Iran oder Venezuela, erleben im Wesentlichen das, was wir einst erlebt haben. Die Erfahrung Litauens lehrt uns, dass wir die moralische Verpflichtung haben, sie zu unterstützen.
Als die Sowjetunion zusammenbrach, war Litauen bereit. Wir waren nicht bereit, weil unsere Institutionen stark waren, sie waren demontiert worden. Wir waren bereit, weil unsere Gesellschaft ihren moralischen Kompass nicht verloren hatte. In Untergrunddruckereien, in Kirchen, in Klassenzimmern, in Exilgemeinden, wir hatten die Idee eines demokratischen Litauens bewahrt.
Wir hatten eine Vision, wir waren geeint und, was entscheidend ist, wir hatten einen Plan.
Und genau das ist es, was wir heute brauchen. Die Verteidigung der Demokratie und die Unterstützung demokratischer Aktivisten dürfen kein nachträglicher Einfall sein, eine gelegentliche Geste, während wir uns auf das konzentrieren, was wichtiger erscheint, wie die Eindämmung von Haushaltsdefiziten oder die Kontrolle der Inflation.
Es muss eine eigenständige Strategie sein, eine mit einem klaren Ziel, bei dem das Endziel nicht Bequemlichkeit ist, sondern die Erhaltung und Stärkung der Demokratie. Eine solche kohärente Strategie brauchen wir heute in Europa.
Ja, autoritäre Regime stürzen, aber was danach kommt, ist nicht garantiert. Eine zusammengebrochene Diktatur hinterlässt ein Vakuum, und die Geschichte zeigt uns, dass die Demokratie es nicht automatisch füllt.
Dies ist eine weitere wichtige Lehre, die wir den heutigen demokratischen Bewegungen mit auf den Weg geben: Widerstand gegen Autokratien ist für die Demokratie notwendig, aber nicht ausreichend.
Autokraten zu stürzen bedeutet nicht, Demokratie aufzubauen. Dies erfordert Vorbereitung, breiten Konsens und demokratisches Engagement, bevor das Regime fällt, nicht danach. Demokratie muss bewusst, inklusiv und strategisch aufgebaut werden.
Forschung und Geschichte zeigen dasselbe Muster erfolgreicher Übergänge vom Autoritarismus zur Demokratie, was in der Regel Folgendes erfordert:
Die erfolgreichsten Übergänge von einem autoritären System zu einer Demokratie finden dort statt, wo es Folgendes gibt:
- ein gemeinsames Verständnis von nationalem Zweck und nationaler Identität,
- einigkeit unter den Oppositionskräften,
- eine klare und realistische Strategie für die Regierungsführung,
- und ein tiefes Bekenntnis zu demokratischen Regeln und Institutionen, auch wenn diese schwierig oder unbequem sind.
Bewegungen, die Freiheit erringen, müssen auch bereit sein, verantwortungsvoll und vorausschauend damit umzugehen. In Litauen haben wir nicht einfach eine herrschende Elite durch eine andere ersetzt. Wir haben unabhängige Gerichte aufgebaut. Wir haben die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt. Wir haben die Rechte von Minderheiten geschützt. Und wir haben 1990 unsere ersten freien Wahlen abgehalten, noch bevor unsere Unabhängigkeit überhaupt von der Welt anerkannt wurde.
Dieses Bekenntnis zur Demokratie, nicht nur im Prinzip, sondern auch in der institutionellen Praxis, trug dazu bei, dass unser Übergang erfolgreich verlief. Und es ist ein Modell, das unserer Meinung nach auch heute noch relevant ist: von Kiew bis Minsk, von Tiflis bis Teheran. Aber seien wir ehrlich: Der härteste Kampf heute ist nicht nur der gegen autoritäre Regime. Es ist auch der gegen Apathie, Müdigkeit und kurzfristiges Denken in unseren eigenen demokratischen Gesellschaften.
Vergessen wir nicht: Die Verteidigung der Demokratie ist kostspielig. Sie erfordert politischen Willen. Sie erfordert schwierige Entscheidungen. Und sie bedeutet, standhaft zu bleiben, auch wenn andere vorschlagen, dass wir uns mit Aggressoren arrangieren oder die Beziehungen zu Regimen normalisieren, die unsere grundlegendsten Werte ablehnen.
Allzu oft, wenn die Schlagzeilen verblassen, wenn sich der Krieg hinzieht, wenn die Kosten steigen, gerät die Unterstützung für die Freiheit ins Wanken. Die Menschen fragen: „Reicht das nicht? Können wir nicht pragmatischer sein?“
Aber Pragmatismus, der die Prinzipien vergisst, ist kein Pragmatismus, er ist Kapitulation unter einem anderen Namen.
Litauen hat seine Freiheit nicht wiedererlangt, indem es auf den richtigen Moment gewartet hat. Wir haben mit Klarheit, Beständigkeit und Überzeugung dafür gekämpft. Heute müssen wir dieselbe Widerstandsfähigkeit zeigen ,nicht nur in unserer Region, sondern in allen demokratischen Gesellschaften. Denn jedes Mal, wenn wir zögern, gewinnt der Autoritarismus an Boden.

Gabrielius Landsbergis bei der Jahresversammlung 2025 / Foto: Michael Leh (IGFM)
Sprechen wir also Klartext, sowohl zu uns selbst als auch zu denen, die auf unsere Führung hoffen:
Freiheit verteidigt sich nicht von selbst. Selbst das Opfer von Tausenden Ukrainern wird nicht ausreichen, es sei denn, wir entscheiden uns dafür, die Demokratie gemeinsam zu verteidigen, und zwar nicht nur, wenn sie in unserem Hinterhof bedroht ist, sondern überall dort, wo sie gefährdet ist.
Die Demokratie wird sich nicht von selbst wieder aufbauen, nachdem der Autoritarismus zusammengebrochen ist. Einigkeit entsteht nicht zufällig, sie muss geschmiedet, aufrechterhalten und geschützt werden.
Deshalb muss unsere Unterstützung für demokratische Bewegungen über symbolische Erklärungen hinausgehen. Wir müssen ihnen helfen, sich darauf vorzubereiten, nicht nur Widerstand zu leisten, sondern auch zu regieren. Wir müssen in Bildung, institutionelle Reformen, Übergangsjustiz und die Zivilgesellschaft investieren, damit diejenigen, die für die Freiheit Opfer gebracht haben, bereit sind, zu gegebener Zeit mit Legitimität und Zielstrebigkeit zu führen.
Am wichtigsten ist, dass wir zeigen, dass wir nicht nur an unsere Werte glauben, sondern auch bereit sind, für sie zu kämpfen. Paradoxerweise ist es oft am realistischsten, sich auf seine Prinzipien zu berufen. Der deutlichste Ausdruck von Pragmatismus ist es, rote Linien zu ziehen ,und sie ernst zu meinen. So senden wir eine Botschaft an jeden Möchtegern-Diktator: Manche Handlungen haben echte Konsequenzen.
Litauens Weg, von der Besatzung über die NATO-, und EU-Mitgliedschaft bis hin zu einem demokratischen Staat unter Gleichen, ist der lebende Beweis dafür, dass ein demokratischer Wandel möglich ist. Aber er beweist auch etwas anderes: Demokratie ist kein Ziel, sie ist eine Disziplin. Und diese Disziplin muss geübt werden, in Friedens, und Krisenzeiten, in Regierungsgebäuden und auf Dorfplätzen, über Kontinente und Generationen hinweg. Heute ist der Kampf für die Demokratie für viele eine Frage des Prinzips.
Für kleinere Nationen wie Litauen ist er aber auch eine Frage des Überlebens. Wir können nur in einer Welt existieren, uns entwickeln und unsere Identität pflegen, in der das Recht und nicht die rohe Gewalt regiert. Nur in einer Weltordnung, die auf demokratischen Regeln basiert, können kleine Staaten frei und souverän bleiben.
Und noch etwas ist wichtig: Demokratien müssen mit Demokraten sprechen, sich gegenseitig unterstützen und Autokraten mit Geschlossenheit entgegentreten, nicht, indem sie sie beschwichtigen, sondern indem sie entschlossen für unsere Werte eintreten, und, wenn nötig, mit Gewalt.
Es mag verlockend sein, mit Autokraten zu verhandeln, die die Illusion von Stabilität oder wirtschaftlichem Gewinn vermitteln. Aber ihre Logik ist nicht Frieden, sondern Herrschaft. Autoritäre Regime halten sich nicht an Regeln, sie versuchen, sie neu zu schreiben. Sie tolerieren keine Unterschiede, sie wollen sie beseitigen.
Mit einer Weltanschauung, die Koexistenz als Schwäche ansieht, kann man keinen dauerhaften Frieden schaffen. Deshalb ist Frieden mit einem Autokraten kein Frieden, er ist nur eine Pause im Kreislauf der Unterdrückung. Und in diesem Kampf gibt es nichts Mächtigeres als das Wissen, dass man nicht allein ist.
Wenn die Menschen in der Ukraine, in Belarus, Syrien, Myanmar und anderen Ländern die härtesten Tage ihres Kampfes durchstehen, müssen sie wissen, dass sie nicht vergessen sind. Litauens Widerstand nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht vorüber, er hielt an. Er hielt an, weil es eine starke Symbiose zwischen unserem inneren Kampfeswillen und dem Wissen gab, dass die freie Welt uns nicht im Stich gelassen hatte. Diese Solidarität war wichtig. Sie gab Kraft. Sie hielt den Mut aufrecht. Sie hielt die Flamme am Leben.
Heute befinden sich die Ukrainer in genau derselben Lage: Sie haben den Willen zu kämpfen, aber sie brauchen dringend die Gewissheit, dass die freie Welt an ihrer Seite steht. Lassen Sie uns diese Gewissheit schaffen, nicht mit Worten allein, sondern mit Taten, die lauter sprechen als Versprechen. Und zum Abschluss sollten wir uns an die Worte von Pastor Martin Niemöller erinnern, die er nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs schrieb:
„Zuerst holten sie die Kommunisten ab, und ich habe geschwiegen, denn ich war kein Kommunist.
Dann holten sie die Gewerkschafter ab, und ich habe geschwiegen, denn ich war kein Gewerkschafter.
Dann holten sie die Juden, und ich schwieg, denn ich war kein Jude. Dann holten sie mich, und es war niemand mehr da, der für mich sprechen konnte.“
Heute klingen diese Worte erschreckend wahr. Während Russland ukrainische Städte bombardiert, Kinder deportiert und versucht, den Willen einer Nation auszulöschen, dürfen wir nicht tatenlos zusehen. Denn wenn wir jetzt schweigen, gibt es vielleicht morgen niemanden mehr, der für uns spricht. Lassen wir uns nicht täuschen. Lassen wir uns nicht entmutigen. Und lassen wir uns nicht spalten. Die Fackel der Freiheit brennt noch. Tragen wir sie gemeinsam, mit Mut, mit Klarheit und mit einem Plan.
Slava, Ukraini!
Danke.