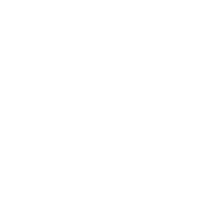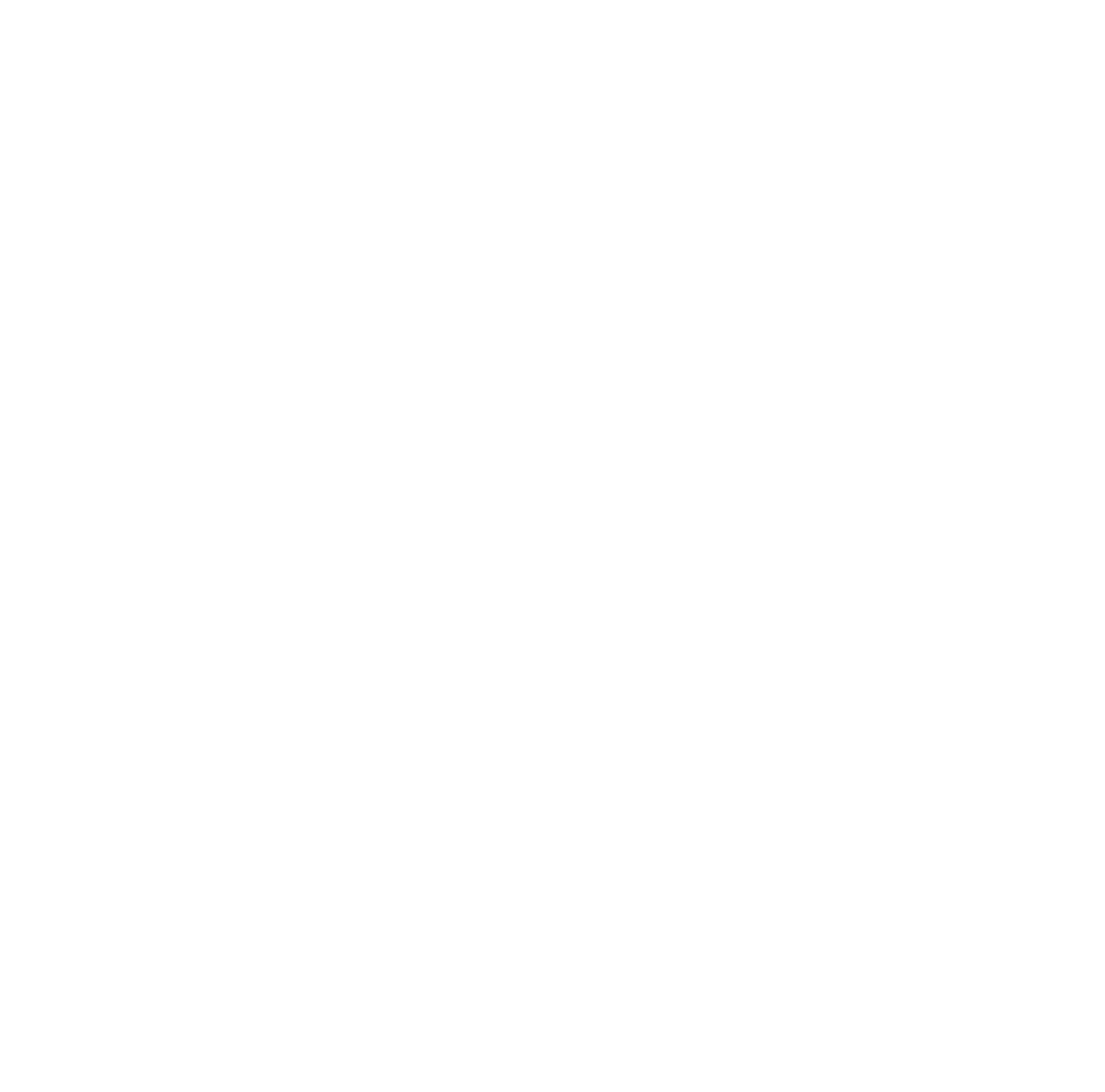Menschenrechte in Nordkorea

Am 1. Dezember 2023 veranstaltete die IGFM in Kooperation mit der südkoreanischen Menschenrechtsorganisation PSOCRE ein Symposium zur aktuellen Menschenrechtslage in Nordkorea. Im Rahmen der Veranstaltung wurden insbesondere die Themen Internetfreiheit, Kontrolle des Zugangs zu Informationen, Klimakrise und Frauenrechte beleuchtet. Zusätzlich konnte eine nordkoreanische Überläuferin Erfahrungen aus erster Hand teilen.
Korea-Symposium mit PSCORE
Nordkorea gilt als die geschlossenste Gesellschaft der Welt. Sowohl Nachrichten, die aus der Außenwelt in das Land gelangen, als auch die Informationen über Nordkorea selbst, die nach außen dringen, werden strengstens vom Staat überwacht und reguliert. Aufgrund der starken Abschottung des Landes gibt es kaum Augenzeugenberichte über die Lebens- und Menschenrechtssituation der nordkoreanischen Bevölkerung.
Umso besonderer war daher die Möglichkeit, die sich im Rahmen des Korea-Symposiums bot, mehr über das alltägliche Leben der Nordkoreaner zu erfahren. Im Fokus standen die Themen Internetfreiheit, Kontrolle des Zugangs zu Informationen, Klimakrise und Frauenrechte. Zu Wort kamen dabei Menschen, die die Verhältnisse dort selbst erlebt haben oder auf wissenschaftlicher Grundlage dazu forschen.
Das Symposium entstand in Kooperation mit der südkoreanischen Menschenrechtsorganisation „People for Successful Corean Reunification“ (PSCORE) und dem „Korean Institute for National Unification“ (KINU), einem von der südkoreanischen Regierung finanzierten ThinkTank, der das Ziel einer friedlichen Wiedervereinigung verfolgt.
Volker Storch, Pressesprecher der IGFM, eröffnete das Korea-Symposium mit einem Grußwort. Bild: IGFM
Nach einem kurzen Grußwort durch die IGFM übergab Pressereferent Volker Storch das Wort an den Direktor der Forschungsabteilung für humanitäre Hilfe und Zusammenarbeit am KINU, Wootae Lee. Seinen Vortrag über Informationszugangs-Kontrolle in Nordkorea und die wachsende Popularität südkoreanischer Pop-Kultur begann der Forscher mit einer Zahl, die einige Zuhörer überraschte. Trotz der starken Abschottung des Landes und der Regulierung des Informationszugangs hätten über 98% der Nordkoreaner bereits einmal ausländische Medien konsumiert – insbesondere Filme aus dem Nachbarland Südkorea wären populär.
Lee führte daraufhin aus, wie sich die Nordkoreaner Zugriff zu diesen Medien verschaffen, dass diese Einfluss auf deren Vokabular und Modestil hätten und zu einem wachsenden Interesse der Bevölkerung am Nachbarland führten. Als Reaktion auf diese Entwicklung erließ die nordkoreanische Regierung in den letzten Jahren drei Gesetze, die unter anderem den Besitz und die Verbreitung sämtlicher Materialien mit Bezug zur südkoreanischen Kultur für verboten erklären sowie Handlungen von jungen Menschen und Regeln für Kleidung, Frisur und Sprache festlegen. Verstöße gegen diese Gesetze würden mit jahrelangen Freiheitsstrafen oder sogar mit der Todesstrafe geahnt, berichtete Lee.
Wootae Lee, Direktor der Forschungsabteilung für humanitäre Hilfe und Zusammenarbeit am KINU, hielt einen Vortrag über die Informationszugangs-Kontrolle in Nordkorea in Bezug auf die wachsende Popularität südkoreanischer Pop-Kultur. Bild: IGFM
Anschließend referierte Bada Nam, Generalsekretär von PSCORE, über „Internetfreiheit“ in Nordkorea. Grundlage seines Vortrags war eine von PSCORE selbst durchgeführte Forschungsstudie über die „globale Internet- und Intranetnutzung in Nordkorea“. Die Grundfrage dieser Studie lautete, ob die Befragten den Zugang zum Internet für ein Menschenrecht halten.
Generell sei es so, dass sofern kein staatlicher beruflicher Bedarf bestünde, die meisten Nordkoreaner überhaupt nicht wüssten, dass das Internet überhaupt existiert. Dementsprechend beschrieben befragte Überläufer den Moment, in dem sie das erste Mal Zugang zum Internet hatten, als lebensverändernd. Bis dahin kannten sie lediglich die von der nordkoreanischen Regierung bereitgestellte „Alternative“ zum freien Internet: das Intranet. Dadurch würde seit Mitte der 1990er Jahre versucht, die Gefahr zu minimieren, aufgrund des Internetzugangs die Kontrolle über Informationen zu verlieren.
Die totalitäre Regierung überwache Kommunikationsfunktionen und -inhalte streng, um die Verbreitung abweichender Meinungen zu verhindern. Praktisch sehe das so aus, dass fast 60 % der Überläufer angaben, Zugriff auf ein elektronisches Gerät wie ein Smartphone gehabt zu haben, der Zugriff jedoch über das Intranet erfolge, das restriktiv sei und streng überwacht werde. Wenn man, als einer der wenigen Nordkoreaner, tatsächlich Zugang zum Internet bekomme, dann nur unter unfassbar strikten Vorschriften. Die Berichte von Überläufern verdeutlichen auch das eindrucksvoll.
Zuletzt resümiert Bada Nam, dass auch wenn derzeit in keinem internationalen Vertrag ein ausdrückliches Recht auf das globale Internet bestünde, es starke Hinweise darauf gäbe, dass in den geltenden Menschenrechtsverträgen ein stillschweigendes Recht darauf bestehe.

In Videointerviews durchgeführt von PSCORE, berichteten nordkoreanische Überläufer von der „Internetfreiheit“ in ihrem Heimatland. Bild: IGFM
Der dritte Beitrag des Symposiums erfolgte durch YongWoo Na, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsabteilung für humanitäre Hilfe und Zusammenarbeit am KINU. In seinem Vortrag über Menschenrechte des nordkoreanischen Volkes im Zeitalter der Klimakrise beschreibt der Forscher zunächst, dass auch in Nordkorea bereits Auswirkungen des Klimawandels zu spüren und die Entwicklungen beunruhigend seien. Genau wie das Nachbarland Südkorea, habe sich auch Nordkorea als Unterzeichner des Pariser-Klimaabkommens zur Einhaltung verschiedener Ziele in diesem Kontext verpflichtet. YongWoo Na beschreibt daraufhin den Zusammenhang von globalem Klimawandel und den Menschenrechten.
In der Zusammenfassung werden drei Bereiche erkennbar, die besonders ins Augenmerk fallen. So hätten aufeinanderfolgende nationale Katastrophen im Zusammenhang mit dem Klimawandel negative Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit der Menschen. Zudem komme es nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in Nordkorea jedes Jahr zu durch Wasser übertragenen Infektionskrankheiten und zuletzt habe auch COVID-19 das Recht der nordkoreanischen Bevölkerung auf Gesundheit beeinträchtigt. Insbesondere durch die lang andauernde Grenzschließung wurde es für Nordkorea schwieriger, Impfstoffe zu beschaffen, was zu einem Rückgang der Impfquote bei Kindern führte.

Bei der Veranstaltung kamen sowohl Mitarbeiter der südkoreanischen Menschenrechtsorganisation PSCORE und des von der südkoreanischen Regierung finanzierten ThinkTanks KINU als auch eine nordkoreanische Überläuferin zu Wort. Bild: IGFM
Eunlee Joung, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei KINU, referierte im folgenden Beitrag über Frauenrechte in Nordkorea, genauer gesagt über die Frage, ob die nordkoreanischen „Jangma-Dang“ einen positiven Effekt auf diese haben. Jangma-Dang sind öffentliche Märkte in der Volksrepublik, die sich seit den frühen 2000er-Jahren aus den einstigen Bauernmärkten entwickelt haben. Mittlerweile gibt es rund 400 dieser Märkte, bei deren Institutionalisierung Frauen eine wesentliche Rolle spielen.
Da den Männern in Nordkorea ihre schlecht vergüteten Berufe meist vom Staat zugewiesen würden, arbeiteten üblicherweise die Frauen auf den Jangma-Dang. Dadurch trügen sie einen Großteil zum Einkommen bei und sind die Versorgerinnen der Familie. Die Jangma-Dang würden daher als fundamentales Element für die Förderung der Frauenrechte angesehen. In der Tat habe besonders die junge sogenannte „Jangma-Dang-Generation“, oder auch „digitale Generation“, ein relativ hohes Gleichberechtigungsgefühl zwischen Männern und Frauen.
Dass dieses aber noch lange nicht bei allen Koreanern angekommen ist, zeigen allein schon die erschreckend niedrigen Zahlen weiblicher Mitglieder des Zentralkomitees der Partei. Die grundsätzliche Verbesserung der Rechte nordkoreanischer Frauen werde Eunlee Joung zufolge durch das politische System sowie das traditionelle feudale Denken verhindert.

Eunlee Joung, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei KINU, referierte über Frauenrechte in Nordkorea und darüber, welche Rolle die öffentlichen Märkte dabei spielen. Bild: IGFM
Zum Abschluss folgte das Highlight des Symposiums: Der Beitrag der nordkoreanischen Überläuferin Evelyn Joeng, die aus erster Hand von ihrem Leben in dem abgeschotteten Land berichtete. So erfuhren die Zuhörer beispielsweise von Evelyns Kindheit in Nordkorea. Auch erzählte sie wie sie mit ihrer Mutter über einen zugefrorenen Fluss nach China flüchten konnte und wie sie von dort aus, nach einem 10-monatigen Aufenthalt in einem Flüchtlingslager in Thailand, die USA erreichte.
Zudem ging Evelyn Joeng in ihren Ausführungen auf die zuvor von den Forschern beschriebenen Themen ein. So berichtete sie von ihrer Wahrnehmung hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels, der Internetfreiheit sowie der Stellung der Frau in der Gesellschaft.

In ihrem Beitrag berichtete die nordkoreanische Überläuferin Evelyn Joeng von ihrer Kindheit in Nordkorea und aus ihrer Flucht, die sie über China und Thailand in die USA führte. Bild: IGFM.