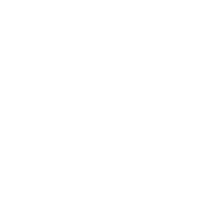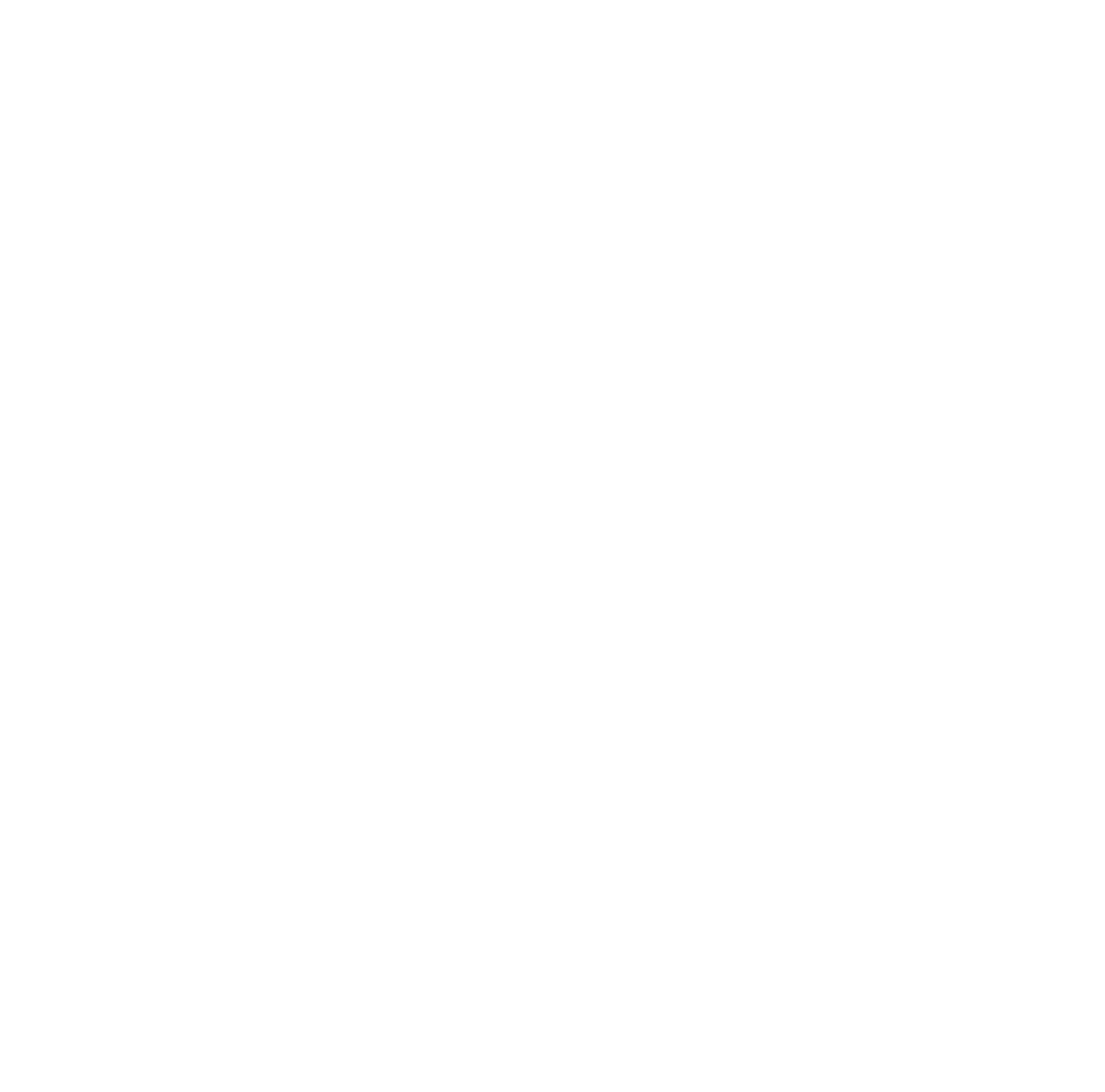Von Michaela Koller
Es war einer der Gewaltakte in Nahost, die im Westen aufhorchen ließen. Vor rund zehn Jahren wurde der chaldäisch-katholische Erzbischof Paulos Faraj Rahho aus dem irakischen Mossul ermordet. Und inzwischen ist die Lage der Christen dort noch trauriger geworden.
Der Mord an Erzbischof Rahho kann nicht genauer als auf den Zeitraum zwischen dem 29. Februar und 12. März 2008 eingegrenzt werden. Seit dem Jahr 2003 war er schon bedroht worden, obwohl er sich für die Verständigung zwischen Muslimen und Christen einsetzte. Am 29. Februar 2008 kam er mit zwei Begleitern von einem Kreuzwegsgottesdienst zurück, als auf ihren Wagen das Feuer eröffnet wurde. Die Mitreisenden und der Fahrer waren sofort tot, während Rahho verschleppt wurde. Zwei Wochen später fand man seinen Leichnam auf einer Müllkippe. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) erinnert an ihn in ihrer Ausstellung „Christenverfolgung im 21. Jahrhundert“ – stellvertretend für so viele andere Opfer. Später erkannte die Weltöffentlichkeit: Anschläge und Entführungen, mit denen der Druck auf die christliche Minderheit im Irak begann, stellten nur das Vorspiel zu schlimmeren Verbrechen dar. Mossul sollte zu dem Schauplatz werden, auf dem IS-Anführer Abu Bakr Al-Baghdadi sein Kalifat ausrief.
Christen lebten bis dahin weitgehend ungestört neben ihren Nachbarn, bevor der IS eindrang und alles umwälzte: Mehr als fünf Millionen Menschen mussten in Folge der Gewalt fliehen. Inzwischen sind mehr als die Hälfte davon zurückgekehrt, darunter laut Internationaler Organisation für Migration (IOM) rund 30.000 Christen. In vielen islamischen Ländern genießen Minderheiten weniger Freiheiten als die Christen in der kurdischen Region: Im Gegensatz zur Türkei darf hier etwa das Aramäische unterrichtet werden. Die Christen waren schon lange gesellschaftlich sehr präsent: Ausschließlich von ihnen bewohnte Dörfer, eigene Kindergärten und Schulen, Medien und Parteien, christlich besetzte Posten in Verwaltung, Parlament und Regierung. Seit dem Sturz Saddam Husseins und dem folgenden Beginn der Instabilität flohen viele vor den Gewaltakten in die kurdische Region.
Der IS löschte das Christentum in Mossul aus
Vor mehr als drei Jahren, nachdem der IS die Niniveh-Ebene überrannt und Mossul eingenommen hatte, flohen zehntausende Christen in die Nähe Dohuk und Erbil vor den Kämpfern mit den schwarzen Fahnen, um sich dort vor Zwang zum Glaubenswechsel, Versklavung oder Ermordung in Sicherheit zu bringen. Die Glocken der Kirchen verstummten, und mit diesen die ganze Stadt: Die sunnitisch-islamischen Fanatiker mit den langen Bärten zerstörten christliche Gotteshäuser und ächteten Musik. Sie zwangen zudem Frauen zur Verschleierung; sie verschleppten und ermordeten, wer sich ihrem System nicht beugte, darunter auch hunderte Christen, und machten die Zivilbevölkerung zu lebenden Schutzschildern. Von Oktober 2016 bis Juli 2017 dauerte die Befreiungsschlacht um Mossul, wobei eine internationale Allianz die irakische Armee aus der Luft unterstützte. Fast 900.000 Menschen flohen. Der Wiederaufbau der zerstörten Stadt wird noch Jahre dauern. Erst recht wird viel Zeit vergehen, bis die Flüchtlinge zurückgekehrt sein werden und mit den Nachbarn, die sich einst mit dem IS arrangierten, einmal friedlich zusammenleben können. Derweil sind jedoch auch schiitische Milizen, direkt unterstützt durch den Iran, in den Norden des Irak vorgedrungen, die den Christen ebenfalls feindlich gesonnen sind: Anfang Oktober griffen Schiitenkämpfer eine Gruppe christlicher Frauen an einem Checkpoint nordöstlich von Mossul verbal an und forderten sie zum Glaubenswechsel auf.
Eine zweite Front ist eröffnet
Christen lebten schon in dieser Gegend, bevor Kurden und Araber kamen. Jetzt geraten sie überall zwischen die Mühlen. Sie sind anhaltend verunsichert, wurden sie dort doch schon Zeugen der Auslöschung des Judentums durch radikal-muslimische Kräfte. Die aktuelle Situation bleibt beängstigend, denn es erscheint unklar, wer oder was die Christen in der Region beschützen kann. Kurdische Politiker werben unter den Christen dafür, die kurdische Unabhängigkeit zu unterstützen. Im Gegenzug versprechen sie Gleichberechtigung. Die christliche Minderheit benötigt aber Garantien, keine Versprechungen.
Rund 93 Prozent der Kurden stimmten in einem Referendum am 25. September für die Unabhängigkeit der Autonomen Region Kurdistan. Die Spannungen mit der irakischen Regierung in Bagdad eskalierten, besonders über die Frage der Kontrolle Kirkuks, woher rund sechs Prozent des weltweit geförderten Öls herkommt. Die Kurden hielten den IS 2014 davon ab, sich der Vorkommen zu bemächtigen. Bis Oktober war Kirkuk noch unter kurdischer Kontrolle, dann besetzte die irakische Armee die Stadt. Es kam darüber zu Gefechten. Die Bewohner der christlichen Dörfer Teleskof und Bakofa flohen im Oktober erneut, um nicht in den Kämpfen zwischen der irakischen Armee und Peshmerga aufgerieben zu werden. Mittlerweile sind sie wieder zurückgekehrt, nachdem sich die Lage beruhigte. Es gibt nun nicht nur die Frontlinie zwischen dem IS und dem Irak, sondern auch noch die, an der sich vor allem im Norden der Niniveh-Ebene Peschmerga und irakische Einheiten gegenüberstehen. Die Zentralregierung hatte die Kurden aufgefordert, die Peschmerga aus den christlich und jesidisch besiedelten Gebieten um Alqosh und Shekhan zurückzuziehen.
Christen kommen nicht zur Ruhe
In der Niniveh-Ebene machen Christen 40 Prozent der Bevölkerung aus. Bereits 2009 kam eine IGFM-Delegation zu dem Ergebnis: „Die Sehnsucht vieler Menschen in der Niniveh-Ebene ist, mehr zu erreichen, als nur die Minderheitenrechte, die ihnen bisher zugestanden werden.“ Die Vision von einer Selbstverwaltung innerhalb einer Föderation ist verlockend. Schon damals fand die Idee einer Volksbefragung über diese Frage großen Zuspruch. Aktuell nehmen erhebliche Teile der Bevölkerung die Kurden als Besatzer wahr; andere betrachten die kurdische Unabhängigkeit pragmatisch und hoffen insgeheim auf Zugeständnisse und Schutz vor islamischen Gewalttätern.
Das Oberhaupt der chaldäischen Katholiken, Patriarch Louis Raphael I. Sako, Stephanuspreisträger von 2011, hatte schon vor der Abstimmung im Gespräch mit der IGFM seine Sorge um die Sicherheit der christlichen Minderheit im Irak vorgetragen. „Ich bin wirklich beunruhigt, weil nicht klar ist, was die Zukunft den Christen bringen wird“, sagte der Patriarch. Die internationale Gemeinschaft und ganz besonders die Nachbarländer seien auch verunsichert. „Wir haben Angst vor einem neuen Krieg, bei dem die Christen nur verlieren können“, warnte der geistliche Würdenträger. Eine so bedrohte Gruppe wie die christliche Minderheit könne sich selbst nicht beschützen. „Allmählich sind wir erschöpft“, betonte Patriarch Sako.
Als oberster Vertreter seiner Gemeinschaft müsse er darauf hinweisen, dass die Christen zu einer leichten Beute würden. Er habe sie auch davor gewarnt, öffentlich Stellung zu beziehen. Er habe beide Seiten, die Regionalregierung und die Zentralregierung, zu einem „mutigen Dialog“ aufgerufen, um noch vor dem Referendum zu einvernehmlichen Problemlösungen zu gelangen.
Vorrangig seien zunächst Stabilität und Versöhnung zwischen allen Gruppen, die Errichtung einer Kultur des Lebens und des Respekts – und schließlich sollte in den Wiederaufbau investiert werden. Der Patriarch betonte, dass es darauf ankomme, den IS auch ideologisch zu besiegen, nicht bloß territorial. Die IGFM setzt sich dafür ein, ein Kriegsverbrechertribunal über die Verbrechen des IS einzurichten.
Helfen Sie mit: www.igfm.de/is-tribunal/
Mehr zum Thema Religionsfreiheit: www.igfm.de/religionsfreiheit/