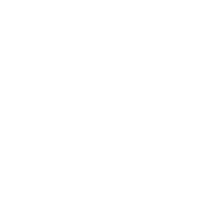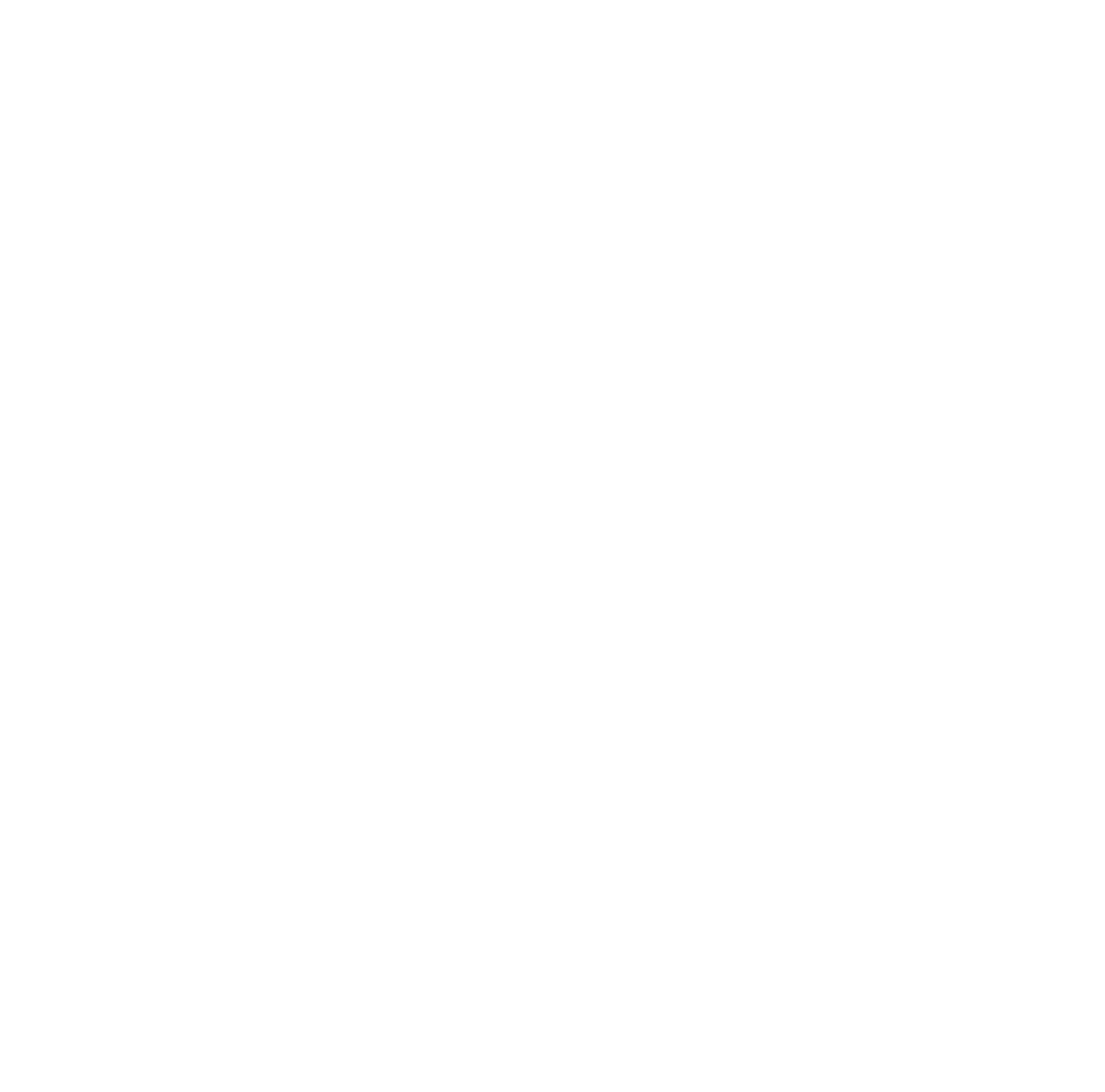Russlands umkämpfte Erinnerung

Soldaten marschieren bei der jährlichen Militärparade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz in Moskau am 9. Mai 2020. Foto: The Presidential Press and Information Office , By kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91513139
Ein Kommentar des ukrainischen Studenten Artem Kryvulia
Veröffentlicht am 8. Mai 2025
Am 9. Mai werden sich Millionen in Russland erneut versammeln, um den Tag des Sieges zu begehen – die Niederlage Nazideutschlands im Jahr 1945. Märsche werden die Straßen füllen, Fahnen werden wehen, und das Staatsfernsehen wird bewegende Ehrungen für die Soldaten des Großen Vaterländischen Krieges ausstrahlen. Doch hinter der Prachtentfaltung verbirgt sich eine mächtige politische Maschinerie, die die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in ein Instrument der Kontrolle, Propaganda und Kriegsführung verwandelt hat.

Eine Gruppe von sechs SU-25BM malt den Himmel in den Farben der russischen Flagge. Militärparade anlässlich des 79. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg in Moskau. von Mil.ru, CC BY 4.0
Während der Westen am 8. Mai den Tag des Sieges in Europa begeht, lohnt es sich zu fragen: Wie hat sich Russlands Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg verändert? Und was passiert, wenn Geschichte nicht mehr als Lehre, sondern als Waffe genutzt wird?
Seit dem Jahr 2000 nutzt Wladimir Putin den Tag des Sieges nicht nur, um der Vergangenheit zu gedenken, sondern um eine politische Mythologie zu erschaffen, die der Gegenwart dient. Seine jährlichen Reden am 9. Mai – gehalten auf dem Roten Platz unter dem Blick der Militärparade und nationaler Symbole – sind zentral für Russlands Erinnerungspolitik. Sie sind mehr als zeremonielle Ansprachen; sie sind strategische Inszenierungen, die darauf abzielen, die Nation unter einer einzigen Erzählung zu vereinen: Russland als ewiger Sieger über den Faschismus, als Hüter der Wahrheit und als moralisches Zentrum der Weltgeschichte.
In den frühen 2000er Jahren betonten Putins Reden Einheit und Erinnerung. Sie ehrten Veteranen, sprachen von Heilung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und vermieden kontroverse politische Aussagen. Doch im Laufe der Jahre – insbesondere nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 – vollzog sich ein deutlicher Wandel. Die Sprache wurde schärfer. Der Westen wurde zu einem dunklen Gegenspieler, dem vorgeworfen wurde, die Geschichte umzuschreiben. Der Sieg von 1945 wurde nicht mehr als Erinnerung an den Frieden, sondern als Präzedenzfall für gegenwärtige Konflikte heraufbeschworen.
Im Jahr 2022 erreichte diese Entwicklung ihren Höhepunkt. In seiner Rede zum Tag des Sieges, gehalten während der großflächigen Invasion der Ukraine, erklärte Putin: „Heute kämpfen unsere Soldaten erneut für unser Volk im Donbass, so wie einst ihre Großväter im Großen Vaterländischen Krieg.“
Die Botschaft war eindeutig: Der Krieg in der Ukraine ist kein Angriffskrieg, sondern eine Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs – ein moralischer Kampf gegen den Faschismus, der sich in modernen Feinden neu manifestiert hat. In dieser Erzählung wird Geschichte nicht erinnert, sondern umfunktioniert.
Diese rhetorische Strategie hat reale Konsequenzen. 2014 verabschiedete Russland ein Gesetz, das „Beleidigungen des militärischen Ruhms und der historischen Erinnerung“ unter Strafe stellt – mit bis zu fünf Jahren Gefängnis. Im selben Jahr unternahm Putin seinen ersten öffentlichen Besuch in das neu annektierte Krimgebiet – anlässlich des Tags des Sieges. Der Feiertag ist zu einer Bühne der Machtdemonstration geworden – innenpolitisch wie international.
Gleichzeitig sagen die Leerstellen in diesen Reden genauso viel wie die Worte selbst. Es fehlen jegliche Hinweise auf sowjetische Verbrechen, den Hitler-Stalin-Pakt oder die Besetzung Osteuropas. Erinnerung wurde kuratiert – vereinfacht zu einer Geschichte des absoluten Guten gegen das absolute Böse, mit Russland stets auf der richtigen Seite.
Das „Unsterbliche Regiment“ – eine ursprünglich zivilgesellschaftliche Bewegung, bei der Bürger:innen mit Porträts von Angehörigen marschieren, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben – war einst ein persönlicher Akt der Trauer und des Stolzes. Seit Putin 2015 selbst an dem Marsch teilnahm, wurde daraus ein staatlich sanktioniertes Ritual, das individuelles Gedenken mit offizieller Ideologie verbindet.
Diese Transformation des Tags des Sieges spiegelt ein tieferes Muster wider, das auch in anderen autoritären Regimen zu beobachten ist. Ähnlich wie Chinas Umgang mit dem Massaker von Nanking oder die Neuinterpretation der Nationalgeschichte unter Erdogan in der Türkei hat die russische Regierung eine Version von Erinnerung institutionalisiert, die Widerspruch ausschließt und aktuelle Politik rechtfertigt. Es ist ein klassisches Beispiel dessen, was Wissenschaftler als „mnemonische Sicherheit“ bezeichnen – der Gebrauch von Erinnerung nicht zum Schutz der Geschichte, sondern zum Schutz des Regimes.
Doch diese Erzählung bleibt nicht unwidersprochen. Unabhängige Historiker:innen, Journalist:innen und zivilgesellschaftliche Gruppen stellen sich dieser Verengung der Vergangenheit entgegen. International bleibt der 8. Mai ein Tag, der nicht der Machtdemonstration, sondern dem Gedenken an die Kosten des Krieges und die Zerbrechlichkeit des Friedens gewidmet ist.
Um diese Entwicklung zu verstehen, muss man betrachten, wie sich die Reden zum Tag des Sieges über die Jahre verändert haben – Amtszeit für Amtszeit:

Russische Soldaten marschieren in einer Militärprozession anlässlich des 60. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs auf dem Roten Platz in Moskau am Montag, den 9. Mai 2005. By White House photo by Eric Draper – The White House President George W. Bush, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80100837
2000–2004: Nationenbildung durch Erinnerung
In einer seiner ersten Ansprachen sagte Putin: „Wir sind verpflichtet, uns daran zu erinnern, was unsere Väter und Großväter durchgemacht haben. Ihr Sieg ist unser Stolz und unser Leitstern.“ Diese Formulierung verankerte die nationale Identität im historischen Opfer und diente dazu, nach dem ideologischen Vakuum der 1990er Jahre Kontinuität herzustellen.
Russland befand sich damals noch in einer Phase der Erholung nach politischem und wirtschaftlichem Umbruch. Die Reden betonten nationale Heilung, Einheit und die Kontinuität mit der sowjetischen Vergangenheit. Der Heldentum der Veteranen wurde gefeiert, der Zweite Weltkrieg als gemeinsame Quelle des Stolzes dargestellt, polemische Aussagen wurden vermieden. Im Jahr 2000 sagte Putin: „Die Lehren des Krieges sollen uns lehren, wachsam zu sein und allen Versuchen, die Wahrheit zu verdrehen und die Geschichte umzuschreiben, zu widerstehen.“
2004–2008: Geschichtshoheit und wachsende Selbstbehauptung
2005 warnte Putin berühmt: „Versuche, die Geschichte umzuschreiben und die Rolle unseres Volkes im großen Sieg zu schmälern, sind gefährlich und unmoralisch.“ Damit zog er eine klare Grenze: Erinnerung war nicht länger passiv – sie wurde zur nationalen Pflicht.
Mit wachsender Stabilität und internationalem Selbstbewusstsein verschärfte sich Putins Rhetorik. Er warnte vor Geschichtsrevisionismus und beschuldigte ausländische Akteure, die sowjetische Rolle im Krieg zu marginalisieren. Formulierungen wie „gefährliche und unmoralische Versuche, die Geschichte umzuschreiben“ wurden zur Norm. Der Tag des Sieges wurde weniger zu einer Reflexion, sondern mehr zu einem Instrument zur Verteidigung von Russlands Platz in der Weltgeschichte. Die staatliche Erzählung verfestigte sich um moralische Überlegenheit und symbolische Kontinuität mit der Sowjetvergangenheit.
2008–2012: Narrative Kontinuität unter Medwedew
Obwohl Dmitri Medwedew das Präsidentenamt innehatte, blieb Putin der eigentliche Machtträger. Die Rhetorik der Kontinuität setzte sich fort. Medwedews Reden griffen die gleichen Themen von Opfer, Stolz und historischer Größe Russlands auf, allerdings mit einem diplomatischeren Ton. Diese Phase bewahrte die zeremonielle Beständigkeit des Feiertags, während im Hintergrund die Rückkehr zur aggressiveren Erzählstrategie vorbereitet wurde.

Bei der Militärparade anlässlich des 65. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg. Links: Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev, Präsident von Kasachstan Nursultan Nazarbayev. Rechts: Der chinesische Staatspräsident Hu Jintao, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10287346
2012–2016: Die Krim-Wende und antiwestliche Rhetorik
In seiner Rede von 2015 erklärte Putin: „Russland wird immer für die Wahrheit, für Gerechtigkeit und für das Andenken an unsere Vorfahren einstehen, die unser Vaterland verteidigt haben.“ Diese Mischung aus moralischer Überlegenheit und geopolitischer Kampfansage verdeutlichte, wie eng Erinnerung und Außenpolitik miteinander verwoben wurden.
Die Annexion der Krim 2014 markierte eine Zäsur – auch in der Siegestagsrhetorik. Putin besuchte zur Feier Sewastopol und verband frühere Triumphe mit heutigen geopolitischen Handlungen: „Wir werden immer stolz darauf sein, dass es unser Volk war, das sich erhob, um die Freiheit zu verteidigen und den Nationalsozialismus zu zerschlagen.“ Russland wurde nicht nur als historischer Sieger, sondern als aktueller Verteidiger der Wahrheit dargestellt – gegen einen feindlichen Westen.
2016–2020: Moralischer Absolutismus und militarisierte Erinnerung
In diesen Jahren wurde der Tag des Sieges zu einem Ritual moralischer Erneuerung stilisiert. Die Rote Armee wurde nicht nur als historische, sondern als mythische Kraft ewiger russischer Tapferkeit gepriesen. Begriffe wie „Wachsamkeit“, „moralische Pflicht“ und „heiliges Gedenken“ dominierten. Über stalinistische Repressionen oder sowjetische Verbrechen wurde geschwiegen. Russland wurde als letzte Bastion gegen den Faschismus dargestellt – gestern, heute und morgen.
2020–2024: Die vollständige Instrumentalisierung der Erinnerung
2023, mitten im andauernden Krieg gegen die Ukraine, verkündete Putin: „Es gibt nichts Stärkeres als unsere Einheit, nichts Heiligeres als die Erinnerung an unseren Sieg. Das ist es, was uns unbesiegbar macht.“ Gedenken ist nun nicht mehr bloße Rhetorik – es ist Mobilisierung.
Diese Phase, geprägt von der COVID-19-Pandemie und dem Ukrainekrieg, markiert den Höhepunkt der Erinnerung als politisches Instrument. 2022 sagte Putin: „Heute kämpfen unsere Soldaten erneut für unser Volk im Donbass, so wie einst ihre Großväter im Großen Vaterländischen Krieg.“ Der Tag des Sieges dient nicht mehr der Rückschau, sondern der Rechtfertigung von Angriffen. Erinnerung wurde zur Doktrin. In seiner Rede von 2023 stellte Putin den Krieg als heilige Mission dar: „Die Einheit unseres multiethnischen Volkes ist Russlands große Stütze, unsere Stärke und unser Stolz. Wir kämpfen für unsere historischen Gebiete, für unser Volk. Wir kämpfen für die Zukunft Russlands.“ Solche Aussagen verwandeln historische Erinnerung in einen Kriegsaufruf – sie verwischen die Grenzen zwischen Trauer und Militarismus, zwischen Ehrung der Toten und Rekrutierung der Lebenden.

Parade zum Tag des Sieges 2013 in Moskau. Foto: Vitaly V. Kuzmin – http://vitalykuzmin.net/?q=node/498, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26283565
Als jemand, der monatelang 25 Jahre an Siegestagsreden analysiert hat, bin ich erstaunt, wie sorgfältig die Vergangenheit in Russlands politischem Theater inszeniert wird. Gedenken ist zur Inszenierung geworden. Erinnerung zum Mittel der Staatsführung.
Wenn wir dieses Jahr an den Zweiten Weltkrieg erinnern, sollten wir nicht nur der gefallenen Soldaten gedenken, sondern auch der Wahrheit, für die sie gestorben sind. Erinnerung ist eine mächtige Kraft – sie kann vereinen, inspirieren und aufklären. Doch wenn sie vom Staat monopolisiert wird, kann sie auch verschleiern, manipulieren und Gewalt rechtfertigen. In Russland ist der Tag des Sieges zu einem Gradmesser der Narrativkontrolle geworden, bei dem Geschichte dem Machtbedürfnis der Gegenwart angepasst wird. Diese Transformation zu verstehen ist essenziell – nicht nur für Wissenschaftler:innen und Menschenrechtsverteidiger:innen, sondern für alle, die sich dafür interessieren, wie Vergangenheit die Zukunft formt.
Erinnerung sollte uns in gemeinsamer Menschlichkeit verbinden – nicht durch konstruierte Mythen spalten.
Artem Kryvulia