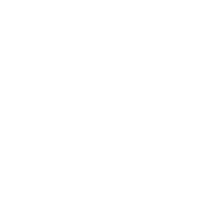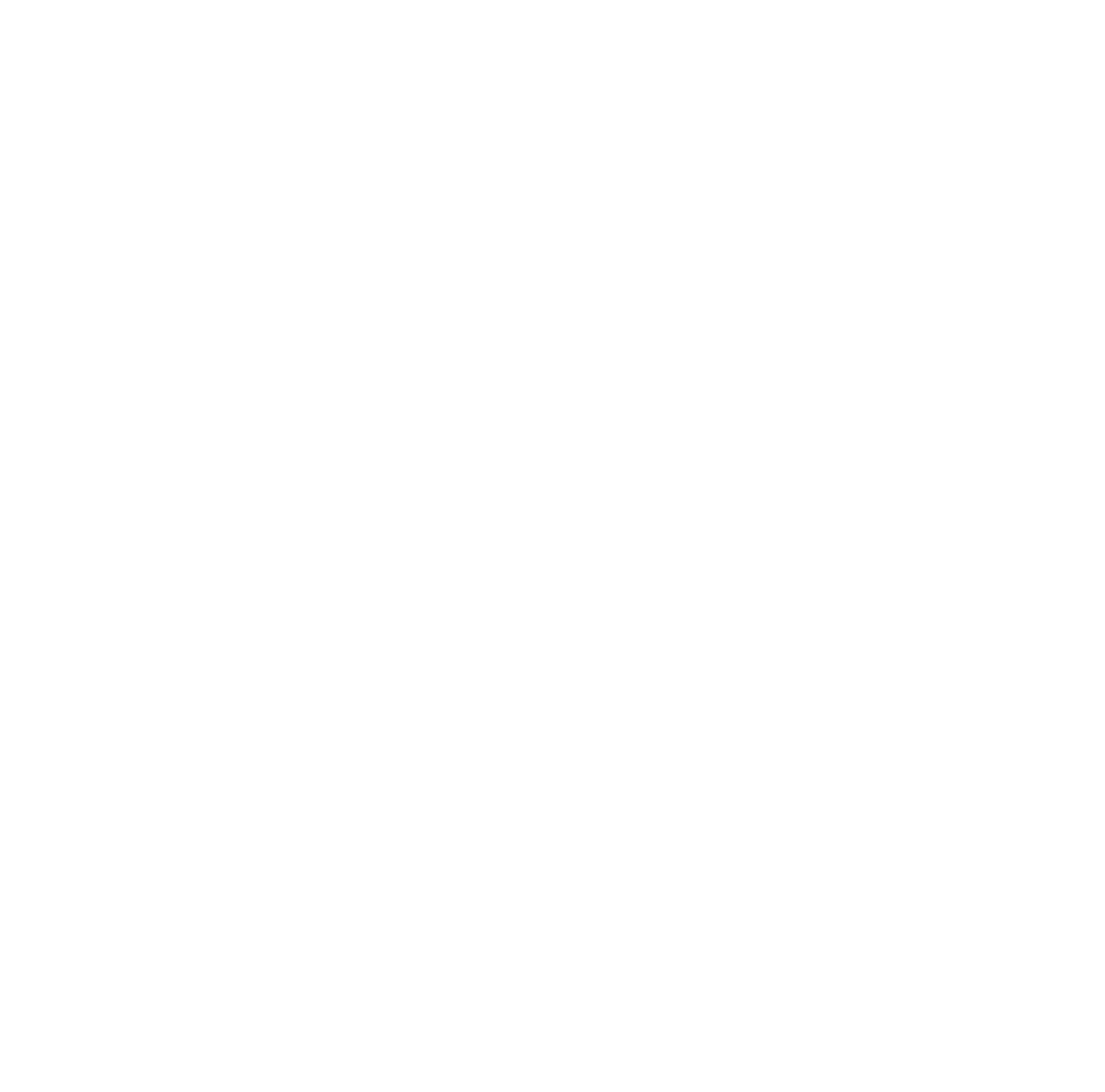Die KSZE-Folgekonferenz 1977 in Belgrad
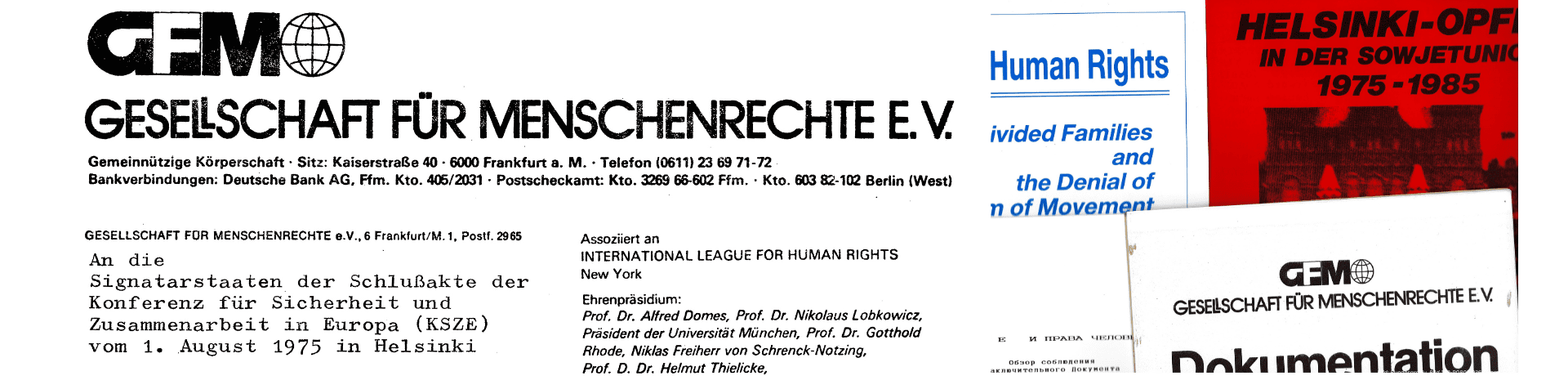
Die GFM reiste vom 1. – 7. Oktober 1977 mit einer internationalen Delegation zur KSZE-Folgekonferenz nach Belgrad. Spektakulärer Höhepunkt der GFM-Reise nach Belgrad waren zwei Pressekonferenzen im Delegierten-Hotel Jugoslavija, an denen etwa 35 internationale Journalisten teilnahmen. Foto: IGFM-Archiv
50 Jahre Helsinki-Abkommen
Die KSZE-Folgekonferenz 1977 in Belgrad
Ein erster großer Erfolg für die GFM
von Edgar Lamm
Die Menschenrechtsdiskussion in Europa und speziell in Deutschland nahm in den 1970er Jahren an Intensität zu. Dies lag insbesondere an der fortdauernden Verletzung eben dieser Rechte in den damaligen Ostblockstaaten und vor allem in der DDR.
Sichtbares Zeichen dafür war die immer weiter verbarrikadierte innerdeutsche Grenze, die zu dieser Zeit neben der Grenze zwischen Nord- und Südkorea vermutlich die „perfekteste“ und undurchlässigste Grenze weltweit war. Zynischer Höhepunkt war die Installation der Selbstschussautomaten SM 70, welche den Schießbefehl und die Minenfelder ergänzten.
So war es auch kein Zufall, dass die Gesellschaft für Menschenrechte (GFM) 1972 gegründet wurde. (Zehn Jahre später wurde aus der GFM durch die Gründung weitere nationaler Sektionen die IGFM – Internationale Gesellschaft für Menschenrechte.)
Vor diesem Hintergrund war die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) für die GFM/IGFM von Beginn an ein wichtiges Aktionsfeld. Dieser „KSZE-Prozess“ – wie an anderer Stelle dieses Buches bereits beschrieben – begann offiziell mit der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte am 1. August 1975 in Helsinki.
Da einem Prozess etwas Dynamisches inne wohnen soll, wurden bei jeder Konferenz eine Folgekonferenz sowie „Expertentreffen“ zu speziellen Themen vereinbart. An den Folgekonferenzen sowie den Sonderkonferenzen zu Menschenrechtsfragen hat die GFM/IGFM regelmäßig teilgenommen. (Siehe Auflistung an anderer Stelle dieses Buches.)
Diese Serie begann für die GFM mit der ersten KSZE-Folgekonferenz (nach Helsinki) in Belgrad im Herbst 1977.
Die GFM reiste also vom 1. – 7. Oktober 1977 mit einer internationalen Delegation nach Belgrad. Sie bestand aus dem Jesuitenpater Wilhelm Bergmann, dem Völkerrechtler Hans-Günther Parplies, dem belgischen Parlamentsabgeordneten Willy Kuijpers, dem späteren britischen Unterhausabgeordneten Matthew Parris sowie Edgar Lamm, dem Sprecher der Delegation.
Ihr Anliegen für der Konferenz in Belgrad formulierte die GFM-Delegation kurz und knapp:
„Die humanitären Anliegen sind nicht nur eine Angelegenheit der Regierungen sondern auch der Bürger der an der Konferenz teilnehmenden Staaten. Aus den uns garantierten Menschenrechten leiten wir die moralische Verpflichtung ab, uns auch für die Menschenrechte anderer einzusetzen.“
Anklage
Im Gepäck hatte die Delegation mehrere Petitionen mit 17.664 in der Bundesrepublik Deutschland gesammelten Unterschriften. Darin beklagte sie u. a. folgende Missstände:
In der Sowjetunion entstanden seit 1976 mehrere Helsinki-Gruppen, die auf die Einhaltung der KSZE-Schlussakte drangen. Ihre Mitglieder, darunter prominente Bürgerrechtler wie Alexander Ginsburg, Jurij Orlow und Anatolij Schtscharanskij, wurden daraufhin verhaftet.
Weiterhin setzte sich die GFM für zahlreiche Russlanddeutsche ein, die Anträge auf Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland gestellt hatten.
In der Tschechoslowakei entstand im gleichen Jahr das Menschenrechtsdokument „Charta 77“. Ihre Unterzeichner wurden Repressalien ausgesetzt bzw. verhaftet, darunter u. a. Pavel Kohut, Vaclav Havel, Jiři Lederer und Vladimir Škutina.
In Polen wurden Mitglieder des „Komitees zur Verteidigung der Arbeiter“ und der „Bewegung für die Verteidigung der Menschenrechte“ verfolgt, darunter z. B. Jacek Kuron, Jan Jozef Lipski und Adam Michnik.
In Rumänien wurden die Angehörigen der deutschen Minderheit vielfach daran gehindert, zu ihren Angehörigen in der Bundesrepublik Deutschland auszureisen.
Die meisten Eingaben erhielt die GFM im Vorfeld der KSZE-Folgekonferenz zum Thema „DDR“. Dabei ging es in erster Linie um die Verfolgung und Verhaftung von Ausreiseantragstellern. Hervorgehoben wurde das Engagement mutiger Bürgerrechtler wie Dr. Karl Heinz Nitschke, Prof. Dr. Hellmuth Nitsche, Rudolf Bahro und Rolf Mainz.
Auch das Gastland Jugoslawien wurde angeklagt aufgrund seiner etwa 600 politischen Gefangenen, darunter seinerzeit bekannte Namen wie Mihajlo Mihajlov und Vitomir Djilas, ein Vetter des einstigen Tito-Stellvertreters Milovan Djilas, den die GFM-Delegation während ihres Aufenthaltes in Belgrad besuchte.
Forderungskatalog
In einem umfangreichen Katalog stellte die GFM-Delegation u. a. folgende Forderungen an die Konferenz:
- Aufhebung des Verbots der Auswanderung und Genehmigung von Besuchsreisen in nicht kommunistische Länder
- Abbau der Selbstschussanlagen und Räumung der Minenfelder an der innerdeutschen Grenze
- Genehmigung zum Bezug von Zeitungen und Literatur aus dem westlichen Ausland
- Verbreitung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der KSZE-Schlussakte in den kommunistischen Ländern
- Aufhebung der gegen Oppositionelle verhängten Arbeits- und Berufsverbote (insb. in der UdSSR, CSSR und DDR)
- Beendigung der Zwangsadoptionen von Kindern, deren Eltern aus politischen Gründen inhaftiert bzw. im Rahmen des Häftlingsfreikaufs in die Bundesrepublik Deutschland abgeschoben wurden
- Garantierung der Religionsfreiheit
- Trennung von kriminellen und politischen Häftlingen in den Gefängnissen
- Verzicht auf den Einsatz krimineller Häftlinge als Vorgesetzte der politischen Häftlinge
Die GFM-Dokumentation für die Belgrader Konferenz schloss mit der den Ereignissen von 1989/1990 voraus eilenden Feststellung:
„Wir wissen, dass die volle Durchsetzung der Menschenrechte in Europa ein längerer Prozess ist, der aber nicht auf unabsehbare Zeit hinaus geschoben werden kann.“
Was die GFM-Delegation auf der KSZE-Konferenz 1977 geleistet hat:
Die originale Dokumentation über den Besuch der internationalen Delegation der Gesellschaft für Menschenrechte vom 1.-7. Oktober 1977 bei der KSZE-Folgekonferenz in Belgrad
Aus der Geschichte der IGFM
Aus der Geschichte der IGFM
Aus der Geschichte der IGFM
Chronik: 50 Jahre IGFM